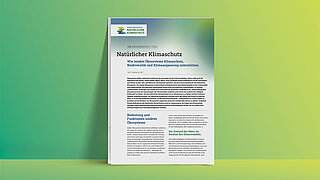„Wild ist das neue Schön!“ – Fachkonferenz zu Strategien und Impulsen für Natürlichen Klimaschutz in Kommunen und Unternehmen
Copyright: ZUG / Toni Kretschmer
Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten für Natürlichen Klimaschutz in Städten und Gemeinden diskutieren – das war das Ziel der Konferenz „Mehr Natur für ein gutes Klima“ am 30.09. und 01.10.2025 in der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft in Berlin.
Mehr als 160 Teilnehmende aus Kommunen, Unternehmen, Behörden und Umweltverbänden kamen dafür zusammen. Hinzu kamen ca. 100 Teilnehmende im Livestream am ersten Tag. Gemeinsam stellten wir uns die Frage, welchen Beitrag die Natur zum Klimaschutz in Städten und Gemeinden leisten kann.
Carsten Träger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Klima, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), nahm in seinem Grußwort Bezug zur Weiterentwicklung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK). Die Vorschläge hierzu hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider am Vortag vorgestellt. Träger betonte, dass mehr als 700 Kommunen bereits durch das ANK über verschiedene Förderangebote gefördert würden. In den aktuellen Haushalts- und Finanzplänen setze die Bundesregierung weiter starke Zeichen für mehr Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie die Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Tom Kirschey, Leiter des Kompetenzzentrums Natürlicher Klimaschutz (KNK), lud anschließend die Teilnehmenden ein, die Konferenz dazu zu nutzen, sich gegenseitig zu inspirieren, zu vernetzen und neue Ideen zu entwickeln. Stadtnatur zu schaffen, sei kein Selbstläufer, aber ein Bereich, der Zuversicht stifte, für die Menschen sichtbar wäre und Lebensqualität mit intakter Natur verknüpfe. Es verbessere das Klima vor Ort – im mehrfachen Sinne des Wortes.
Die anschließenden Impulse und Gespräche machten deutlich: Urbane Räume und Natürlicher Klimaschutz spielen füreinander eine wichtige Rolle. Starke urbane Ökosysteme sind wirksame Klimaschützer – und Natürlicher Klimaschutz hat vielfältigen Nutzen für Städte und Gemeinden.
Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats für Natürlichen Klimaschutz
Prof. Dr. Katrin Rehdanz, Umwelt- und Energieökonomin an der Christian-Albrechts-Universität Kiel und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Natürlichen Klimaschutz (WBNK), fasste in ihrer Keynote die Herausforderungen des Natürlichen Klimaschutzes in Städten und Gemeinden zusammen – darunter die gestiegene Pro-Kopf-Wohnfläche und der „Bau-Turbo“, aber auch der vergleichsweise hohe Investitionsbedarf. Flächenverbrauch gehe pauschal in die Treibhausgas-Bilanz ein, darüber hinaus würde die Senkenwirkung von Natur- und Umweltmaßnahmen auf Siedlungsflächen bislang nicht berücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund sei es deshalb umso wichtiger, den breiten Nutzen von Stadtgrün aufzuzeigen: Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, Katastrophenvorsorge, Kühlung, Gesundheit, Lebensqualität u.v.m.
Der WBNK habe deshalb in seiner Stellungnahme zum ANK empfohlen, dass Natürlicher Klimaschutz im Siedlungsbereich gestärkt werden sollte. Die Eckpunkte:
- Finanzielle Unterstützung
- Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen
- Verbesserte Bilanzierung
- Aktive Einbindung der Bevölkerung
Stellschrauben für mehr Stadtnatur
Beim Austausch zum Thema kommunales Planungshandeln war „integriertes Verwaltungshandeln“ ein Schlüsselwort. Es gebe kaum ein kommunales Handlungsfeld, das Klima und Klimaanpassung nicht betrifft. Die vielen Ansprechpartner*innen und Behörden einzubeziehen, koste Zeit und Ressourcen – aber hilft, „Schubläden“ zu öffnen und Verbündete zu finden. Zwei Beispiele: Die örtliche Feuerwehr hinsichtlich des Katastrophenschutzes sowie das Gesundheitsamt für den Hitzeschutz. Weitere Stellschrauben für Natürlichen Klimaschutz in Kommunen sind das Berücksichtigen von Stadtnatur beim Wohnungsbau, die Achtung sozialer Gerechtigkeit im Zugang zu urbanem Grün sowie Umweltbildung weitere zentrale Stellschrauben.
Einig waren sich die Teilnehmenden bei ihren Erfahrungen, dass Projekterfolge grundsätzlich nur möglich sind durch intensive Kommunikation mit allen Stakeholdern – von den Anwohner*innen bis zum Tiefbauamt. „Wild ist das neue Schön!“ müsse an vielen Stellen erst vermittelt und erlebbar gemacht werden. Türöffner dafür seien auch Bündnisse mit Unternehmen und Zivilgesellschaft.
Austausch an Infoständen, in Arbeitsgruppen und auf Exkursionen
Am zweiten Tag der Fachkonferenz konnten sich Teilnehmende persönlich zu Fachfragen und Förderangeboten beraten lassen. Im ANK-Café boten Vertreter*innen von Kommunen für biologische Vielfalt e.V., dem Zentrum KlimaAnpassung und dem Projekt „Tausende Gärten und Tausende Arten“ die Möglichkeit zum Austausch und informierten über Unterstützungsangebote. Auch Fragen zu Förderangeboten für Kommunen und Unternehmen wurden an Infoständen der KfW und ZUG direkt beantwortet.
In den anschließenden Arbeitsgruppen wurde es konkret: Die Teilnehmenden diskutierten und berieten sich zu Umsetzungsfragen von Natürlichem Klimaschutz in Siedlungen – von Planungsinstrumenten bis zur naturnahen Gestaltung von Firmengeländen.
Die Ergebnisse aus den Gesprächen waren vielfältig:
- Ein hilfreiches Instrument zur Qualifizierung von Grünflächen sei die Bauleitplanung (Satzungen, z.B. Baumschutzsatzung, Grünordnungspläne). Damit könnten neben öffentlichen auch private Grünflächen (vertikales Grün, Dachbegrünung) qualifiziert und gefördert werden.
- Orientierungswerte für öffentliches Grün nehmen Erholungs-, Klima-, Gesundheits- und Biodiversitätsfunktion in den Blick und könnten bestehende Planwerke optimieren.
- Für die Umsetzung von Stadtnatur-Maßnahmen müsse man Gelegenheiten nutzen: Das reiche zum Beispiel von Sturmereignissen, die Stadtbäume beschädigt haben, bis zu städtebaulichen Planungen wie etwa notwendigen Leitungsbau sowie den Bau von Mobilitätsstationen.
- Natürlicher Klimaschutz auf Firmengeländen hat einen vielfältigen Mehrwert, darunter etwa das Gewinnen und Halten von Fachkräften und Kund*innen.
Im Anschluss konnten die Konferenzteilnehmenden noch an einer von fünf Exkursionen zu Berliner Best-Practice-Projekten teilnehmen und damit nach dem vielfältigen Austausch nochmal in die Praxis eintauchen.
Das Interesse und die Motivation der Vertreter*innen aus Kommunen, Unternehmen und Zivilgesellschaft an Austausch war durchweg sehr groß. Wir danken allen Teilnehmenden für ihre vielfältigen Impulse, konkreten Fragen und gegenseitigen Tipps für mehr Natürlichen Klimaschutz in Städten und Gemeinden.
Die Präsentationen und Poster der Veranstaltung finden Sie hier.
Ergebnisbericht, Präsentationen und Poster
Der Ergebnisbericht sowie alle Präsentationen und Poster finden Sie auf der Veranstaltungsseite der Fachkonferenz.